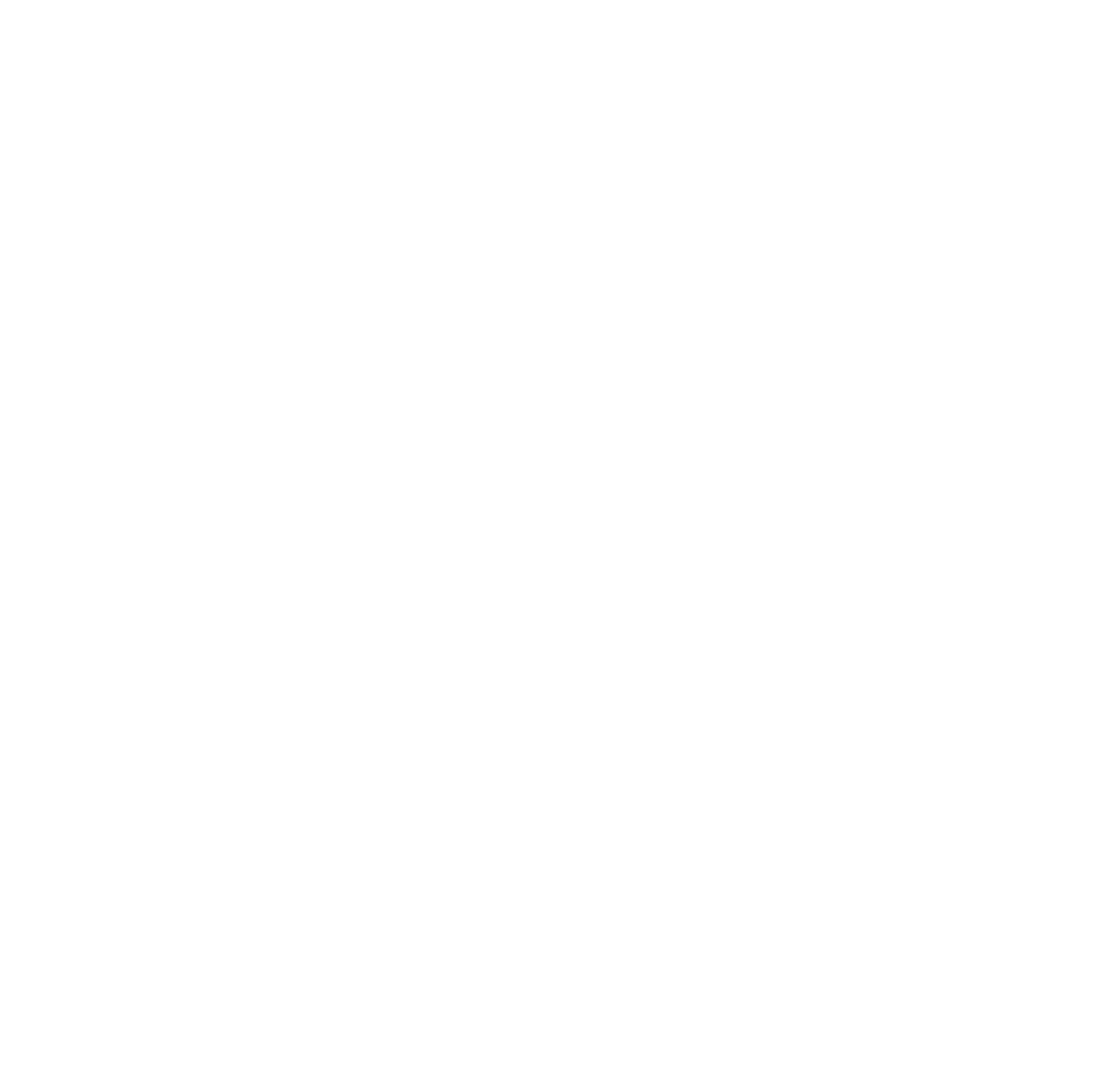Integration...
...geht uns alle an

"Es ist das Jahr 2024. In der Bundesrepublik Deutschland gibt es nur noch drei Landesfeuerwehr- verbände: Nord, Mitte und Süd. Zahlreiche Jugendfeuerwehren wurden geschlossen, oder aber es wurden Verbünde mit anderen Jugendfeuerwehren oder Hilfsorganisationen eingegangen. Dieser Trend ging auch an den Freiwilligen Feuerwehren nicht spürbar vorüber, immer wieder schließen Feuerwehren. Der flächendeckende Brandschutz wird zunehmend über Pflichtfeuerwehren sichergestellt, größere Kommunen haben ihre Beschäftigten gar zu Hilfsgruppen in Sachen Brandschutz und Hilfeleistung zusammengefasst, um noch einigermaßen Hilfe vor Ort leisten zu können.
Mit dem Sterben der Feuerwehren und der Jugendfeuerwehren in den Städten und in den Dörfern verstärkt sich die Individualisierung, auch das Vereinsleben wird weniger, die Dörfer und Städte verkommen zu reinen Arbeits- und Schlafsiedlungen, ein gemeinsames miteinander leben findet nicht mehr statt.
Ist dies ein mögliches Szenario, Fiktion oder kommende Wirklichkeit? Ich weiß es nicht. Eines jedoch ist klar, mit der Zeit verändern sich die Verhaltensweisen und Lebensabläufe der Menschen und der "Umwelt" in der sie leben. Sei es durch veränderte Arbeitsprozesse im Berufsleben, oder die Individualisierung mit einem Weg vom gemeinsamen Erleben, hin zu einem Machen was, wann und wo man will.
Ein Jugendverband wie die Deutsche Jugendfeuerwehr (DJF) muss sich dieser Herausforderung stellen, der Herausforderung auch in der Zukunft eine aktive, belebende, integrative Jugendarbeit anzubieten und durchzuführen. Der Deutsche Jugendfeuerwehrausschuss hat dies erkannt und eine Grundsatzdiskussion zur Thematik "Integration in den Jugendfeuerwehren" geführt.
Dieses Thema scheint für einige weit weg. Unter Integration wird oft das Eingliedern von ausländischen Mitbürgerninnen und Mitbürgern in unsere Gesellschaft bzw. in gesellschaftliche Gruppen verstanden. Dies ist aber zu kurz gegriffen. Integration bedeutet mehr, auch für die Jugendfeuerwehren und die Freiwilligen Feuerwehren.
Integration rückt als gesellschaftspolitische Anforderung immer stärker in den Fokus. Auch die politisch Verantwortlichen in den Kommunen, den Landkreisen und den Ländern, bis hin zum Bund, fordern, ja sie erwarten dies, von allen gesellschaftlichen Gruppen, und somit auch von uns, den Feuerwehren und Jugendfeuerwehren. Hierzu einige Denkanstöße und Ansätze.
Zunächst etwas zur Bevölkerungsentwicklung
Statistische Erhebungen zeigen auf, dass der Altersdurchschnitt in Deutschland steigt. Immer weniger Kinder und Jugendlichen stehen einer wachsenden Zahl älterer Bürger gegenüber.
Weniger Kinder und Jugendliche? Dies wird auch in den Jugendverbänden seine Spuren hinterlassen.
Jugendverbände werden zu Konkurrenten, ganz zu schweigen von den Auswirkungen, wenn sich die Übertritte von der Jugendfeuerwehren in die Einsatzabteilungen drastisch reduzieren.
"Gott zu Ehr – dem Nächsten zur Wehr"
Schon heute ist der Nächste in unserer Gesellschaft mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 5 ein Mensch mit Migrationshintergrund (dies sind i. d. R. zugewanderte, eingebürgerte bzw. in Deutschland geborene Ausländer), in den Jugendfeuerwehren besteht derzeit ein Verhältnis von 1 zu 26. Wenn es nicht erreicht wird, dass sich dieses Verhältnis bewegt und ein gutes Stück anpasst, werden die Jugendfeuerwehr und auch die Freiwillige Feuerwehr nicht mehr auf die notwendige Akzeptanz bei großen Teilen der Bevölkerung und der Politik stoßen und eben die bevölkerungspolitische Realität nicht wiederspiegeln.
Behindert ist man nicht – Behindert wird man gemacht


Behinderung darf kein K.O-Kriterium in der Jugendfeuerwehr sein, zahlreiche positive Beispiele aus Jugendfeuerwehren belegen das. Es müssen verstärkt Anstrengungen unternommen werden, damit unser Anspruch und unsere Zusage gilt „Bei uns ist Jede und Jeder willkommen!“. Hier wird wertvolles Potenzial nicht ausreichend genutzt, die gewünschte Vielfalt und Barrierefreiheit gilt es zu stärken und zu fördern.
Soweit, so gut. Und was können die örtliche Jugendfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr hierzu beitragen? Was werden/können wir, die DJF, vor allem tun?
Die DJF hat das bundesweite Integrationsprojekt „Unsere Welt ist bunt“ durchgeführt, welches von der „Stiftung für Demokratie und Toleranz“ und dem Bundesjugendministerium getragen, gestützt und gefördert wurde. Diese Projekt sah in seiner ersten Stufe die Sensibilisierung der Organisation DJF und ihrer Protagonisten vor. Mit Flyern, Plakaten und Freecards sollte Aufmerksamkeit und Interesse bei den Jugendfeuerwehren für ein Mitmachen geworben werden.
Das Projekt wurde auch kommunikativ begleitet, hierzu ist natürlich an erster Stelle das Lauffeuer, die DJF-Verbandszeitung, zu nennen. Wir haben über Beispiel Projekte aus Jugendfeuerwehren berichtet – und unter anderem Interviews mit Verantwortlichen aus der Politik, der Wirtschaft und den Feuerwehren geführt.
Als ein weiterer Baustein der Konzeption wurde die Entwicklung von Arbeitshilfen für Jugendfeuerwehrwartinnen und Jugendfeuerwehrwarte voran getrieben. Wir haben Seminare und Workshops entwickelt, um die Betreuerinnen und Betreuer zu sensibilisieren und um für „das tägliche Geschäft“ in der Jugendfeuerwehr Unterstützung anzubieten. Der größte, aber auch der aktivste Brocken in unserem Integrationsfahrplan waren die Integrationsprojekte und -aktionen vor Ort. Quer durch Deutschland haben sich Jugendfeuerwehren hieran beteiligen. Natürlich wurde dann die Frage gestellt: „Was kann man denn da konkret machen?“
Integration ist mehr als nur ausländische Jugendliche in Jugendfeuerwehren aufzunehmen. Die Jugendfeuerwehren konnten sich unter anderem mit folgenden Themenschwerpunkten am Integrationsprojekt beteiligen:
1. Jugendarbeit mit/für Jugendliche mit Migrationshintergrund
Sicherlich treffen hier verschiedene Kulturen und verschiedene Sprachen aufeinander. Es wäre jedoch falsch, dies von vornherein als Hemmnis anzusehen. Unterstützen können hierbei auch andere Jugendverbände und -organisationen, welche bereits Erfahrungen in der Jugendarbeit mit ausländischen Kindern und Jugendlichen haben. Kooperationen sollten hier nicht ausgeschlossen werden und erscheinen möglich.
2. Stärkung des Mädchenanteils
Der Mädchenanteil in den Jugendfeuerwehren liegt derzeit bei rund 25 %, in den Freiwilligen Feuerwehren der Frauenanteil jedoch nur bei 7 %. Hieraus wird erkennbar, dass dieser Themenschwerpunkt auch ein Thema für die sogenannte „Erwachsenenfeuerwehr“ ist. Dies hat der Deutsche Feuerwehrverband erkannt und hierzu auch ein Projekt gestartet. Ziel muss es sein, den Anteil von Mädchen und Frauen in unseren Feuerwehren zu stärken, aber bitte nicht nur um die Tagesalarmbereitschaft sicher zu stellen, wenn die Männer auf der Arbeit sind. Jungen und Mädchen, Männer und Frauen müssen gleichberechtigte Partner in der Wehr sein.
3. Jugendfeuerwehrarbeit mit und für Kinder und Jugendliche mit Behinderung
„In der Jugendfeuerwehr und der Freiwilligen Feuerwehr kann nur tätig sein, wer die geistige und körperliche Fitness besitzt“, mit diesem Spruch wird leider hier und da das Thema oft beendet. Ist das aber wirklich so, kann bei uns wirklich nur der Leistungssportler mitmachen? Oder können hier nicht gerade die Jugendfeuerwehren integrativ wirken? Wir haben die besten Voraussetzungen: die feuerwehrtechnische und die allgemeine Jugend arbeit, das gemeinsame Spielen – Arbeiten – Erleben in der Gruppe. Hier können wir die Werte vermitteln, dass jede und jeder in der Gesellschaft seinen Platz hat, auch bei uns.
4. Stärkere Beteiligung der Jugendlichen an der Planung und Durchführung ihrer Jugendarbeit (Partizipation)
Kinder und Jugendliche wollen ernst genommen und beteiligt werden, diese Anforderung stelt auch das Kinder- und Jugendhilfegesetz an die in der Jugendarbeit tätigen Verbände. Nicht immer scheint dies in unserem Verband umsetzbar zu sein. Wer plant und steuert die Jugendarbeit? Wie viele Kameradinnen und Kameraden sollen oder dürfen bei Übungen und Einsätzen mitreden? Was lässt ein hierarchischer Aufbau, den Feuerwehr nun mal hat und in einzelnen gewissen Bereichen auch haben muss, zu? Mit dem Einrichten von Jugendforen auf all unseren Ebenen haben wir einen ersten, großen Schritt getan. Weitere werden folgen müssen, damit „wir Alten“ die Jugendlichen noch besser verstehen und an die Jugendfeuerwehr und damit auch an die Feuerwehr binden können.
5. Verbesserung der Akzeptanz zwischen der Jugendfeuerwehr und den Einsatzabteilungen
Spontaneität und der Wille auch mal was Neues, Unkonventionelles auszuprobieren müssen natürlich vorhanden sein. Gemeinsames Üben, Lernen und Arbeiten in der Wehr von Alt und Jung sollte ebenso möglich sein, wie auch alterspezifische Angebote.
Die Deutsche Jugendfeuerwehr legte großen Wert darauf, dass diese Themenliste für die Projekte vor Ort nicht abschließend und vollständig ist. Die Jugendfeuerwehren wurden angehalten, eigene Schwerpunkte für sich zu definieren und diese anzugehen.
Abwarten, bis Kinder, Jugendliche und Erwachsene von sich aus auf uns zukommen, reicht nicht, diese Zeiten sind vorbei. Wir müssen um unsere „Zielgruppe“ werben, offen auf sie zugehen, das Gespräch suchen und informieren ... und uns dabei für möglichst viele „öffnen“. Dazu gehört auch, selbstkritisch zu sein, eine innerverbandliche Diskussion zuzulassen und zu führen.
Wenn wir hierzu wirklich bereit sind, uns auf die Wanderung zwischen Wünschen, Notwendigkeiten und Möglichkeiten zu begeben, wenn wir dazu wirklich bereit sind, eine Standortbestimmung und einen Modernisierungsprozess durchzuführen, um uns hieraus ableitend für die Zukunft auszurichten, dann können wir getrost und mit Zuversicht dem Jahr 2024 entgegen sehen, oder?
Willi Donath - Fachausschussvorsitzender Jugendpolitik & Integration 2009-2022